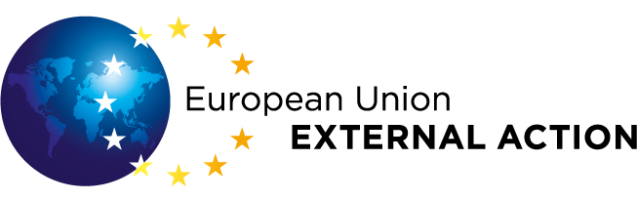Die Zeit - Josep Borrell: "Wir alle haben die Krallen des Bären gesehen"

Interview originally published here: https://www.zeit.de/politik/2022-05/josep-borrell-g7-nato-ukraine
Nach einem langen Tag voller Arbeitssitzungen und bilateraler Gespräche beim G7-Außenminister-Treffen tritt Josep Borrell, 75, am späten Freitagnachmittag in Begleitung mehrerer Mitarbeiter aus dem weißen Schloss. Er schreitet durch die weitläufige, bis auf den letzten Grashalm bewachte Parkanlage zum "Peerstall", dem einstigen Pferdestall. Dort findet das Interview statt. Eine gute halbe Stunde nimmt er sich Zeit für das Gespräch, er wirkt konzentriert und – trotz der schwierigen Themen – entspannt.
ZEIT ONLINE: Sie haben beim Treffen der G7-Außenminister angekündigt, dass die EU weitere 500 Millionen Euro für die militärische Unterstützung der Ukraine bereitstellen will, insbesondere für schwere Waffen wie Panzer und Artillerie. Haben die europäischen Staaten sich darauf verständigt, was das strategische Ziel dieser Hilfe ist?
Josep Borrell: Insgesamt sind es nun zwei Milliarden Euro, welche die EU der Ukraine zur Verfügung gestellt hat. Wir haben das Tabu gebrochen, dass die EU keine Waffenkäufe finanzieren dürfe – wobei diese zwei Milliarden natürlich nur ein kleiner Teil dessen sind, was die einzelnen europäischen Staaten aufbringen. Unser Ziel ist es, der Ukraine dabei zu helfen, eine Invasion abzuwehren. Russland hat die Ukraine überfallen, so wie Napoleon einst Spanien überfiel, und die Ukrainerinnen und Ukrainer wehren sich. Dabei müssen wir sie unterstützen, bis es ihnen gelingt, die Angreifer aus ihrem Land zu vertreiben.
ZEIT ONLINE: In letzter Zeit haben die westlichen Bündnispartner widersprüchliche Botschaften gesendet: Aus den USA hieß es, Russland solle so geschwächt werden, dass es nie wieder einen solchen Angriffskrieg führen könne. Joe Biden sagte, Wladimir Putin könne nicht im Amt bleiben – worauf das Weiße Haus erklären musste, dass man keinen Regimewechsel in Russland anstrebe. In Europa fürchten derweil manche, dass diese forsche Rhetorik den Konflikt eskalieren lassen könnte. Haben Sie im Kreis der G7-Minister über dieses Problem gesprochen?
Borrell: Es ist kein Krieg des Westens gegen Russland, das betone ich ausdrücklich. Wir wollen die Ukrainer unterstützen, damit sie die Souveränität ihres Territoriums verteidigen können, das bis zum 24. Februar unter ihrer Kontrolle war. Was bedeutet es, wenn man sagt, man wolle Russland schwächen? Wenn man einen Krieg führt, möchte man den Gegner natürlich schwächen. Wir als Teil des Westens führen jedoch keinen Krieg gegen Russland.
ZEIT ONLINE: Also haben die Amerikaner sich missverständlich ausgedrückt?
Borrell: Ein Satz, der aus dem Kontext gerissen wird, kann auf unterschiedliche Weise interpretiert werden. Natürlich haben wir keine gute Beziehung zu Putins Regime. Und unsere Beziehung zu Russland wird schwierig bleiben, wenn Putin weiterhin regiert. Wir sprechen ja von "Putins Krieg". Dieser Krieg zwischen Russland und der Ukraine wird unsere Beziehungen prägen, mehr noch: Er wird die geopolitische Weltkarte verändern und überall auf der Welt kollaterale Effekte haben.
ZEIT ONLINE: Wie sehen diese Effekte aus?
Borrell: Ich komme gerade aus Südamerika und reise demnächst nach Afrika, und auf all meinen Reisen stelle ich fest, dass die Menschen den Krieg in der Ukraine unterschiedlich deuten. Sie teilen nicht unbedingt unsere westliche Sichtweise. Es gibt Antiamerikanismus in Lateinamerika, Antikolonialismus in afrikanischen Staaten, oft höre ich Vorwürfe wie jenen, dass wir ukrainische Flüchtlinge angeblich besser behandelten als syrische. Oder dass wir, also der Westen, ja auch andere Länder angegriffen hätten. Ich erlebe viel Groll auf die reichen Länder des Westens. Viele Länder des globalen Südens wollen uns nicht einfach blind folgen. Wir müssen versuchen, die Welt auch durch ihre Augen zu sehen, und ihnen die Tatsachen und die Lage besser erklären.
ZEIT ONLINE: Beim G7-Treffen in Weißenhaus wurde viel über die Auswirkungen des Krieges auf die globale Ernährungssicherheit gesprochen, und über den drohenden Hunger in afrikanischen und asiatischen Ländern. Gibt es eine Lösung?
Borrell: Diese Auswirkungen sind global und in manchen Fällen dramatisch. Die Preise für Lebensmittel, Strom und Gas waren schon vor dem Krieg gestiegen, jetzt hat sich der Anstieg massiv beschleunigt. Das trifft uns alle, aber vor allem trifft es die ärmeren Menschen. Und die russische Propaganda lässt viele glauben, die Sanktionen seien daran schuld. Das müssen wir kontern und erklären, dass es der Krieg ist, der die Preise in die Höhe treibt. Wenn ein Schiff voller Getreide den Hafen von Odessa nicht verlassen kann, liegt das nicht an den westlichen Sanktionen, sondern an der russischen Blockade.
ZEIT ONLINE: Lässt sich diese Blockade denn irgendwie umgehen oder lösen?
Borrell: Es gibt zwei Wege. Einer ist, mit den Russen zu verhandeln und sie dazu zu bringen, die Häfen der Ukraine freizugeben. Das Problem ist, dass diese Gewässer voller Minen sind. Man kann die Häfen also nicht einfach öffnen wie eine Tür. Der zweite Weg ist der Transport über die Schiene. Derzeit braucht ein Güterzug mit Weizen allerdings rund 20 Tage, um die Ukraine zu verlassen. Das können und wollen wir beschleunigen, denn ich sehe momentan nicht, wie sich die maritime Route öffnen ließe.
ZEIT ONLINE: Optimistischer klangen Sie, als Sie über das geplante Embargo der EU gegen russisches Öl sprachen. Was lässt Sie hoffen, dass am Ende auch Ungarn zustimmen wird?
Borrell: Es wäre mehr als ein Embargo: Wir wollen den Import von russischem Öl in die EU verbieten. Das ist nicht einfach, gerade für Binnenstaaten wie Ungarn, und wir sollten keine Ankündigungen zu Entscheidungen machen, bevor wir eine Einigung haben. Aber am Ende werden wir eine Einigung haben, davon bin ich überzeugt.
ZEIT ONLINE: Wie lange braucht die EU noch, bis ein ähnliches Importverbot auch für russisches Gas möglich ist?
Borrell: Das ist etwas anderes, denn Gas ist nicht nur eine Energiequelle, sondern auch ein unersetzlicher Rohstoff für die Petrochemie. Deshalb brauchen wir andere Gasquellen, um auf russisches Gas verzichten zu können. Außerdem müssen wir Gas sparen. Es ist der Moment für Austerität – was Deutschland in der Finanzkrise gepredigt hat, gilt jetzt vor allem für den Energieverbrauch; jedes Kilowatt zählt. Und drittens müssen wir so schnell wie möglich auf alternative Energien umsteigen.
ZEIT ONLINE: Ein anderes großes Thema dieser Tage: Treffen Finnland und Schweden die richtige Entscheidung, wenn sie der Nato beitreten?
Borrell: Ob richtig oder nicht, es ist ihre Entscheidung. Jeder Staat hat das Recht darauf, selbst über seine Allianzen zu entscheiden. Bis jetzt überwogen für Finnland und Schweden die Vorteile der Neutralität. Aber wenn man sieht, was um einen herum geschieht, ändert man vielleicht seine Meinung.
ZEIT ONLINE: Lässt sich verhindern, dass diese Entscheidung den Konflikt mit Russland verschärft?
Borrell: Natürlich wird Russland darin einen weiteren Beleg für sein Narrativ sehen, dass der Westen es umzingelt, provoziert und seine Sicherheitsbedürfnisse missachtet. Dieses Narrativ beruht auf der russischen Vorstellung, dass die Welt in Einflusssphären aufgeteilt sei.
ZEIT ONLINE: Zumindest wirkt es bislang so, als ob dieser Krieg die Nato stärker machte.
Borrell: Die Nato spielt in diesem Krieg keine wichtige Rolle. Sie hat mehr Truppen in jene Mitgliedsstaaten entsandt, die an Russland grenzen, aber dort herrscht kein Krieg. Viel wichtiger sind in diesem Krieg die USA, Kanada, Großbritannien und die Europäer. Die Nato liefert aber keine Waffen an die Ukraine.
ZEIT ONLINE: Trotzdem wird sie wieder mehr gebraucht.
Borrell: Die Nato wurde einst als Verteidigungsbündnis gegen die sowjetische Bedrohung gegründet, die seit Anfang der 1990er Jahre nicht mehr existiert. Doch auf einmal ist da jemand, der wie ein Erbe der Sowjets – oder der russischen Zaren – auftritt. Die Nato wurde wiederbelebt, weil der Grund für ihre Existenz wieder aufgetaucht ist.
ZEIT ONLINE: Beobachten Sie einen ähnlichen Effekt – mehr Einigkeit und Handlungsfähigkeit – auch bei der EU?
Borrell: Nichts verbindet mehr als ein gemeinsamer Gegner, eine gemeinsame Bedrohung. Sicherlich wird diese Bedrohung in Vilnius anders wahrgenommen als in Lissabon, aber seit dem 24. Februar haben wir alle, wie sagt man? Auf Spanisch würde man sagen: Wir alle haben die Krallen des Bären gesehen.
ZEIT ONLINE: Erhöht das die Chancen, dass die Europäer nun eine gemeinsame Verteidigungsstrategie entwickeln?
Borrell: Es ist mein Job, dafür zu kämpfen, und das tue ich, seit ich in diesem Amt bin. Wissen Sie, der Euro wurde auch nicht von einem Tag auf den anderen eingeführt. Die Leute haben das längst vergessen, aber für eine Weile hatten wir eine gemeinsame Währung, die nicht die einzige Währung war. Mit den nationalen Armeen könnte es ähnlich sein. Sie werden weiterhin existieren, aber wenn die Europäer wollen, können sie ihre militärischen Kräfte bündeln und effizienter nutzen.
ZEIT ONLINE: Was soll Europa tun, wenn all die Unterstützung der Ukraine nicht zum gewünschten Ergebnis führt, sondern zu einem langen Zermürbungskrieg?
Borrell: Dann werden in erster Linie die Ukrainerinnen und Ukrainer die Leidtragenden sein. Es sind die Menschen in der Ukraine, die leiden, die ihr Land und ihre Unabhängigkeit verteidigen. Und wenn wir ihnen sagen, dass sie auch unsere Werte verteidigen, dürfen wir sie nicht im Stich lassen. Wir dürfen nicht müde werden. Wir müssen sie weiter unterstützen – und gleichzeitig eine diplomatische Lösung zu Bedingungen der Ukrainer suchen. Eines Tages wird dieser Krieg enden. Und wenn dieser Tag kommt, muss die Ukraine in einer Position der Stärke sein.