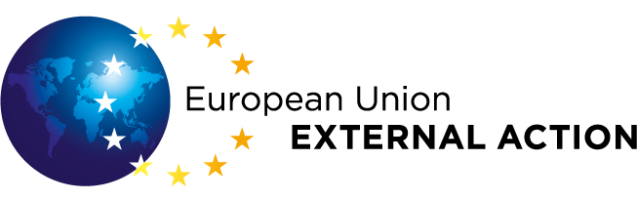Indo-Pazifik: Die EU braucht einen strategischen Ansatz

„Wir haben ein großes Interesse am Indo-Pazifik – von Handel und Investitionen bis hin zu Konnektivität, Klimaschutz und Sicherheit. Wir sollten unseren Teil dazu beitragen, dass die regionale Ordnung offen und regelbasiert bleibt.“
Seit einiger Zeit arbeitet die EU an einer umfassenden politischen Strategie für Asien, die auf zwei Säulen beruht: Zum einen wollen wir unsere Beziehungen zu China neu austarieren, indem wir den Ansatz verfolgen, China als „Partner, Konkurrent und Rivale“ zu behandeln. Gleichzeitig engagieren wir uns verstärkt dafür, unsere Beziehungen mit dem Rest Asiens, insbesondere mit gleichgesinnten Partnern, auszubauen.
Wir arbeiten derzeit an beiden Aspekten. Was China betrifft, so ist unsere Agenda komplex und anspruchsvoll: Wir arbeiten in globalen Fragen zusammen, gehen aber dort, wo es erforderlich ist, auf Gegenkurs und konzentrieren uns auf Gegenseitigkeit und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der EU. Wir müssen mit China zusammenarbeiten, denn es wäre sinnlos, diese Großmacht zu ignorieren – aber wir müssen dabei unsere Augen offen halten. Ich stehe in engem Kontakt mit Staatsratsmitglied und Außenminister Wang Yi, um die Botschaften und Erwartungen der EU in Bezug auf die bilaterale und multilaterale Agenda zu übermitteln. Gemeinsam mit Präsidentin von der Leyen werde ich dem Europäischen Rat auf seiner Frühjahrstagung einen Bericht über den Stand der Umsetzung unserer China-Politik vorlegen. Im Grunde geht es bei unserer China-Strategie darum, bei globalen Fragen zusammenzuarbeiten, unsere Interessen und Werte zu wahren und uns gleichzeitig bewusst zu sein, dass wir unsere Einflussmöglichkeiten erhöhen und bestimmte Anfälligkeiten verringern müssen. Letztlich werden die Entscheidungen, die von Peking ausgehen, die Art und Tiefe unserer Beziehungen beeinflussen.
„Asien ist groß und vielfältig und sollte nicht auf China beschränkt werden – ganz im Gegenteil. In den vergangenen Jahren haben wir unsere Beziehungen zu Japan, Indien, Südkorea, dem ASEAN, Australien und Neuseeland gestärkt und diversifiziert.“
Asien ist jedoch groß und vielfältig und sollte nicht auf China beschränkt werden – ganz im Gegenteil. In den letzten Jahren haben wir unsere Beziehungen zu Japan, Indien, Südkorea, dem ASEAN, Australien und Neuseeland gestärkt und diversifiziert und unsere seit jeher starken Wirtschaftsbeziehungen durch eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik ergänzt. Hier einige Meilensteine:
- Japan und die EU haben ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft und ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen unterzeichnet. Was die wirtschaftliche Liberalisierung betrifft, ist das Abkommen zwischen der EU und Japan das bislang größte Freihandelsabkommen. Wir haben auch ehrgeizige Freihandelsabkommen mit Südkorea, Vietnam und Singapur geschlossen und kommen bezüglich unserer Abkommen mit Australien und Neuseeland rasch voran.
- Im Mai 2018 verpflichteten sich die EU-Außenministerinnen und ‑minister, die sicherheitspolitische Zusammenarbeit der EU mit den Partnern in Asien zu vertiefen. Um dieses Ziel umzusetzen, haben wir das Projekt „Verstärkung der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit in und mit Asien“ ins Leben gerufen. Dabei arbeiten wir beispielsweise mit Partnern wie Indien, Indonesien, Japan, Singapur, Südkorea und Vietnam in den Bereichen maritime Sicherheit, Cybersicherheit, Bekämpfung von Terrorismus und gewaltbereitem Extremismus oder bei der Ausbildung für friedenserhaltende Missionen zusammen.
- Wir haben eine EU-Strategie zur Förderung der Konnektivität angenommen, um unsere Vision eines nachhaltigen, umfassenden und regelbasierten Ansatzes im Bereich der Konnektivität voranzubringen. Auf dem von der EU im Oktober 2018 veranstalteten 12. ASEM-Gipfel haben 53 Partner aus Asien und Europa eine Definition für nachhaltige Konnektivität befürwortet.
- Im vergangenen Dezember konnten wir nach einer langjährigen Vertiefung unserer Zusammenarbeit mit dem ASEAN unsere Beziehungen zu einer strategischen Partnerschaft aufwerten.
Es ist wichtig, dass wir jetzt auf diesen Fortschritten aufbauen und unsere Arbeit intensivieren. Dabei gibt es aus meiner Sicht drei Schwerpunktbereiche:
1. Festlegung eines Ansatzes der EU für den Indo-Pazifik
Der Indo-Pazifik ist in vielerlei Hinsicht das wirtschaftliche und strategische Gravitationszentrum der Welt. Das war schon vor der Pandemie so und ist es heute noch mehr. Diese Region, in der der indische und der pazifische Ozean zusammenkommen und die sich von Ostafrika bis zum Westpazifik erstreckt, ist ein integrierter strategischer Raum. Es ist wichtig für uns, dass wir als EU in vielfacher Hinsicht mit dieser Region verbunden sind: durch Beziehungen in den Bereichen Handel, Investitionen und Sicherheit.
„Die EU hat großes Interesse an der indopazifischen Region und ist darauf bedacht, dass die regionale Architektur offen und regelbasiert bleibt.“
Im Indo-Pazifik befinden sich die weltweit am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften, auf die 62 % des globalen BIP entfallen. Die Region ist der zweitgrößte Absatzmarkt der EU, und vier unserer zehn wichtigsten Handelspartner sind dort ansässig. Die EU hat also ein großes Interesse an der indopazifischen Region und ist darauf bedacht, dass die regionale Architektur offen und regelbasiert bleibt.
Wir wollen mit vielen Partnern zusammenarbeiten, um unsere gemeinsamen Grundwerte und ‑prinzipien zu fördern. Ein gutes Beispiel dafür ist die Teilnahme des japanischen Außenministers Motegi an der Tagung des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ im Januar (externer Link). Er hielt einen sehr interessanten Vortrag über Japans Vision eines „freien und offenen Indo-Pazifik“ und über das Potenzial für Zusammenarbeit zwischen der EU und Japan in zahlreichen Fragen – von der maritimen Sicherheit über einen regelbasierten Handel und regelbasierte Investitionen bis hin zu hochwertiger Infrastruktur und der Vermeidung von „Schuldenfallen“. Viele EU-Außenministerinnen und ‑minister teilten die zentrale Botschaft, dass die EU und Japan in einer Welt des starken Machtwettbewerbs und des Zerfalls der regelbasierten Ordnung ein großes Interesse an einer verstärkten Zusammenarbeit haben.
„Ziel der EU ist es, eine gemeinsame Vision für ihr künftiges Engagement im Indo-Pazifik zu entwickeln.“
Da mehrere EU-Mitgliedstaaten (z. B. Frankreich, Deutschland und die Niederlande) eine nationale Strategie oder Leitlinien für den Indo-Pazifik angenommen haben, ist es an der Zeit, dass die EU das auch tut. Unser Ziel ist es, in den kommenden Monaten eine gemeinsame Vision für das künftige Engagement der EU im Indo-Pazifik zu entwickeln. Wir werden dies auf jeden Fall in umfassender und inklusiver Weise angehen und uns auf die Unterstützung regionaler und multilateraler Ansätze konzentrieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass es dabei genauso um unser Handeln im Indo-Pazifik geht wie um unsere Zusammenarbeit mit den Ländern der Region in den Bereichen Handel und Investitionen, Klima und Biodiversität, neue Technologien oder neue Sicherheitsbedrohungen. Der gemeinsame Nenner wird unser Interesse sein, regelbasierte Ansätze zu entwickeln und aufrechtzuerhalten.
2. Grundlegende Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen der EU und Indien
Innerhalb des Indo-Pazifik spielt Indien zweifellos eine entscheidende Rolle. Die EU und Indien setzen sich seit langem gemeinsam für eine regelbasierte internationale Ordnung und Demokratie ein. Aber – seien wir ehrlich – das Potenzial dieser Beziehungen wurde in der Vergangenheit nicht voll ausgeschöpft. Glücklicherweise haben beide Seiten in den letzten Jahren einen ernsthaften Versuch unternommen, neue Impulse zu setzen.
„Indien hat seinerseits beschlossen, seine Beziehungen zur EU zu intensivieren. Dies ist zum Teil auf den zunehmenden Einfluss Chinas, aber auch auf den Brexit zurückzuführen, da Neu-Delhi jetzt London nicht mehr als einzigen Zugangspunkt zu „Europa“ betrachten kann.“
Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Indien wird in den nächsten zehn Jahren zum bevölkerungsreichsten Land der Welt werden, wobei 50 % der Menschen jünger als 25 Jahre sind. Die EU muss ihre Beziehungen zu einem derart bedeutenden Land weiter ausbauen. Indien hat außerdem beschlossen, seine Beziehungen zur EU zu intensivieren. Dies ist zum Teil auf den zunehmenden Einfluss Chinas, aber auch auf den Brexit zurückzuführen, da Neu-Delhi jetzt London nicht mehr als einzigen Zugangspunkt zu „Europa“ betrachten kann. Es besteht also auf beiden Seiten ein gemeinsames Interesse auf höchster politischer Ebene, was sich in Fortschritten auf operativer Ebene niederschlägt.
Auf dem Gipfeltreffen EU-Indien im vergangenen Jahr wurde das Interesse an einer verstärkten Zusammenarbeit in wichtigen bilateralen und multilateralen Bereichen wie der Energiewende, der digitalen Wirtschaft, der Konnektivität sowie der Sicherheits- und Außenpolitik bekräftigt, in denen Indien die EU allmählich als wichtigen Partner betrachtet. Es besteht ein großes Potenzial, diesbezüglich noch mehr zu tun, da Indien derzeit ein nichtständiges Mitglied im VN-Sicherheitsrat (2021-2022) ist, im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (2019-2021) sitzt und 2023 den Vorsitz der G20 innehaben wird.
Die nächste große Gelegenheit, die Zusammenarbeit zwischen der EU und Indien voranzubringen wird sich im Mai in Porto im Rahmen eines Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der EU-27 bieten, an dem auch Premierminister Modi, der Präsident des Europäischen Rates und die Präsidentin der Europäischen Kommission teilnehmen werden. Wir hoffen, im Rahmen dieses Treffens eine Konnektivitätspartnerschaft zwischen der EU und Indien ins Leben zu rufen. Mit ihr sollen die Bereiche Digitales, Energie, Verkehr und Konnektivität von Menschen abgedeckt werden, indem die EU und Indien bilateral zusammenarbeiten, aber auch indem wir uns gemeinsam um eine bessere Vernetzung mit Drittländern und ‑regionen bemühen. Wir hoffen auch, auf dem Gipfel ehrgeizige klimapolitische Verpflichtungen im Vorfeld der COP26 bekräftigen zu können. Schließlich wird auch der Ausbau der Handels- und Investitionsbeziehungen wichtig sein, wobei beide Seiten auch in dieser Hinsicht hohe Erwartungen haben, echte Fortschritte zu erzielen.
3. Intensivierung unserer Arbeiten im Bereich der Konnektivität
Die Konnektivität ist seit Jahren ein Schlagwort bei den strategischen Beratungen in der indopazifischen Region. Die Pandemie hat das Gefühl der Verbundenheit und gegenseitigen Abhängigkeit in strategischen Bereichen verstärkt. Wie immer lautet die entscheidende Frage: Wer kontrolliert die Abläufe und wer bestimmt die Regeln und Normen?
„Der europäische Ansatz für die Konnektivität, bei dem Regeln, Nachhaltigkeit, lokale Vorteile und Eigenverantwortung im Mittelpunkt stehen, entspricht den Vorstellungen vieler in der Region. Allerdings ist dies ein wettbewerbsintensiver Bereich: Einige große Akteure gehen im Kampf um die Vorherrschaft bei den Normen sehr entschlossen vor.“
Viele asiatische Partner begrüßen ein stärkeres europäisches Engagement. Der europäische Ansatz für die Konnektivität, bei dem Regeln, Nachhaltigkeit, lokale Vorteile und Eigenverantwortung im Mittelpunkt stehen, entspricht den Vorstellungen vieler in der Region. Allerdings ist dies ein wettbewerbsintensiver Bereich: Einige große Akteure gehen im Kampf um die Vorherrschaft bei den Normen sehr entschlossen vor. Daher muss die EU bei der Gestaltung der regionalen Ordnung nach der Pandemie proaktiv vorgehen und ihre wirtschaftlichen und sonstigen Vorteile nutzen, indem sie mit gleichgesinnten Partnern zusammenarbeitet, wo immer dies sinnvoll ist.
Minister Motegi betonte beispielsweise auf der Tagung des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ gegenüber den EU-Außenministerinnen und ‑ministern, dass eine nachhaltige Konnektivität notwendig ist und dass die EU und Japan eng zusammenarbeiten sollten. Dies war der Hauptgrund dafür, dass die EU und Japan bereits 2019 eine Konnektivitätspartnerschaft abgeschlossen haben. Seitdem haben wir mit unseren gemeinsamen Grundsätzen der Nachhaltigkeit und hochwertigen Infrastruktur, aber auch mit konkretem Einsatz vor Ort, Fortschritte erzielt – sei es im Energiesektor in Kenia, bei Verkehrskorridoren in Afrika oder bei der Zusammenarbeit im Bereich der Cybersicherheit mit Partnern im ASEAN. Wir leisten bereits einen erheblichen Beitrag, um den Masterplan des ASEAN für Konnektivität zu unterstützen, und hoffen, wie bereits erwähnt, im Mai eine Konnektivitätspartnerschaft mit Indien zu vereinbaren.
„Im Bereich der Konnektivität ist die EU eine Großmacht. Die allgemeine Wahrnehmung unterscheidet sich jedoch stark von der Realität: In den sechs Jahren zwischen 2013 und 2018 stellte die EU weltweit öffentliche Entwicklungshilfe in Höhe von 410 Mrd. € bereit, während Chinas Beitrag für denselben Zeitraum bei 34 Mrd. € lag.“
Im Bereich der Konnektivität unterscheidet sich die allgemeine Wahrnehmung jedoch stark von der Realität. Diese Wahrnehmungslücke ist insofern von Bedeutung, als die Konnektivität ein wichtiger Teil der geopolitischen Landschaft ist. Zur Erinnerung: In den sechs Jahren zwischen 2013 und 2018 stellte die EU weltweit öffentliche Entwicklungshilfe in Höhe von 410 Mrd. € bereit, während Chinas Beitrag für denselben Zeitraum bei 34 Mrd. € (externer Link) lag. Selbst bei Chinas Vorzeigeinitiative der „Neuen Seidenstraße“ beliefen sich die durch öffentliche Schuldenaufnahme – und nicht mit Zuschüssen – finanzierten Projekte in diesem Zeitraum nach Schätzung der Weltbank auf 464 Mrd. € (externer Link). Die EU ist mit insgesamt 11,6 Billionen € im Vergleich zu China mit 1,9 Billionen € (externer Link) die bei weitem größte Quelle ausländischer Direktinvestitionen. Die EU war und bleibt eine Großmacht im Bereich der Konnektivität – sowohl in der EU selbst als auch außerhalb. Wir müssen uns jedoch auch selbst als Großmacht sehen. Wir müssen uns diese Stärken zunutze machen, um einen strategischen Ansatz festzulegen und umzusetzen und dabei mit dem Privatsektor, den Entwicklungsbanken der EU und anderen öffentlichen Finanzinstitutionen und den EU-Mitgliedstaaten zusammenarbeiten.
Konnektivität bedeutet, Menschen miteinander zu verbinden, und Diskussionen darüber können abstrakt oder diskursiv sein. Strategisch zu sein bedeutet, Prioritäten in Bezug auf Regionen und Sektoren festzulegen und sich vor allem für einige wenige Vorzeigeprojekte zu entscheiden. Die Menschen sollten ganz konkret erkennen können, was die EU und ihre Partner tun.
„Der Bereich der Konnektivität ist ein gutes Beispiel dafür, dass geoökonomische und geopolitische Aspekte ineinander übergehen, und das muss sich auch in unserem Handeln zeigen.“
Wir beschweren uns oft darüber, dass die EU nur als Geld- und nicht als Impulsgeber wahrgenommen wird. Oder darüber, dass wir zwar einen großen Markt und die Macht zur Festsetzung von Standards haben, aber dies nicht als Instrument zur Förderung der strategischen Ziele der EU nutzen. Der Bereich Konnektivität bietet die Chance, diese Wahrnehmung zu ändern. Er ist ein gutes Beispiel dafür, dass geoökonomische und geopolitische Aspekte ineinander übergehen, und das muss sich auch in unserem Handeln zeigen. Ich bin mir aufgrund meiner Aufgabe, die Außenpolitik der Mitgliedstaaten im Rat zu koordinieren und die Kohärenz der Außenpolitik der Kommission sicherzustellen, durchaus bewusst, wie wichtig vernetztes Denken und Handeln ist. Wir müssen die Konnektivität zu einem vorrangigen Arbeitsbereich machen, sowohl für die Erholung nach der Pandemie als auch für die allgemeine Außenpolitik der EU im Indo-Pazifik und darüber hinaus.
Weitere Blog-Beiträge des Hohen Vertreters der EU Josep Borrell
MORE FROM THE BLOG

"Ein Fenster zur Welt"- Blog des HR/VP Josep Borrell
Blog von Josep Borrell über seine Aktivitäten und die europäische Außenpolitik. Hier finden Sie auch Interviews, Stellungnahmen, ausgewählte Reden und Videos.